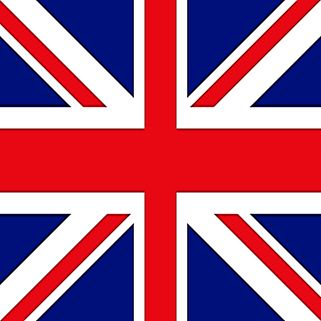Über uns
Wir sind ein internationales Team von Verhaltens- und Evolutionsbiologen mit Sitz am Leibniz-IZW in Berlin und im Ngorongoro-Krater in Tansania. Unsere Forschung erfolgt in enger Zusammenarbeit mit der Ngorongoro Conservation Area Authority und Kooperationspartnern aus internationalen Forschungseinrichtungen. Wir beteiligen uns aktiv an Wissenschaftskommunikation und begrüßen und fördern eine möglichst große Vielfalt an Ideen, Fähigkeiten, wissenschaftlichen Disziplinen und Ansätzen sowie des kulturellen Hintergrunds.
Das Team
 Oliver Höner. Wissenschaftler, Kodirektor, administrativer Leiter und Kurator der Datenbank seit Projektbeginn im Jahr 1996. Oliver untersucht die öko-evolutionären Prozesse, die das Sozialverhalten, die Lebensgeschichte und die Fitness von Tüpfelhyänen prägen. Dazu gehören Partnerwahl, sexuelle Konflikte, soziale Dominanz, Geschlechterrollen, kulturelle Vererbung und Ausbreitung. Seine aktuelle Arbeit konzentriert sich auf drei Themen: (i) wie sich demografische, verwandtschaftliche und ökologische Dynamiken auf die soziale Organisation und die Fitness von Hyänen auswirken, (ii) wie sich die sozialen und genetischen Eigenschaften von Gruppen auf die demografische Widerstandsfähigkeit von Populationen und deren Reaktion auf den Klimawandel auswirken, und (iii) die sozio-ökologischen Ursachen von Konflikten zwischen Menschen und Raubtieren. Er ist Mitglied der IUCN Hyena Specialist Group. Schweizer und Brasilianer.
Oliver Höner. Wissenschaftler, Kodirektor, administrativer Leiter und Kurator der Datenbank seit Projektbeginn im Jahr 1996. Oliver untersucht die öko-evolutionären Prozesse, die das Sozialverhalten, die Lebensgeschichte und die Fitness von Tüpfelhyänen prägen. Dazu gehören Partnerwahl, sexuelle Konflikte, soziale Dominanz, Geschlechterrollen, kulturelle Vererbung und Ausbreitung. Seine aktuelle Arbeit konzentriert sich auf drei Themen: (i) wie sich demografische, verwandtschaftliche und ökologische Dynamiken auf die soziale Organisation und die Fitness von Hyänen auswirken, (ii) wie sich die sozialen und genetischen Eigenschaften von Gruppen auf die demografische Widerstandsfähigkeit von Populationen und deren Reaktion auf den Klimawandel auswirken, und (iii) die sozio-ökologischen Ursachen von Konflikten zwischen Menschen und Raubtieren. Er ist Mitglied der IUCN Hyena Specialist Group. Schweizer und Brasilianer. Eve Davidian. Postdoc am Institut des Sciences de l’Evolution de Montpellier (ISEM, CNRS, Frankreich). Eve stiess 2010 zum Team und ist seit 2020 Kodirektorin und wissenschaftliche Leiterin des Ngorongoro-Hyänenprojekts. Sie wendet Konzepte und Theorien aus der Verhaltensökologie, der Evolutionsbiologie und der Sozioendokrinologie an, um die Ursachen und Fitnesskonsequenzen individueller Strategien und Entscheidungen zum Erwerb von Ressourcen, Partnern, sozialen Verbündeten und Macht bei in Gruppen lebenden Tieren zu untersuchen. Eve nutzt dafür in erster Linie die langfristigen empirischen Daten der Tüpfelhyänen des Ngorongoro-Kraters, wendet für ihre Forschung aber auch vergleichende Ansätze an. Aktuell beschäftigt sie sich mit zwei Hauptthemen: (i) die Auswirkungen der demografischen und verwandtschaftlichen Dynamik auf soziale Konventionen und (ii) die öko-evolutionären Ursachen von Machtungleichheiten und Dominanzstilen bei sozialen Säugetieren. Gefördert von der DFG. Französin, US-Amerikanerin, Armenierin, Libanesin, mit mexikanischer Note.
Eve Davidian. Postdoc am Institut des Sciences de l’Evolution de Montpellier (ISEM, CNRS, Frankreich). Eve stiess 2010 zum Team und ist seit 2020 Kodirektorin und wissenschaftliche Leiterin des Ngorongoro-Hyänenprojekts. Sie wendet Konzepte und Theorien aus der Verhaltensökologie, der Evolutionsbiologie und der Sozioendokrinologie an, um die Ursachen und Fitnesskonsequenzen individueller Strategien und Entscheidungen zum Erwerb von Ressourcen, Partnern, sozialen Verbündeten und Macht bei in Gruppen lebenden Tieren zu untersuchen. Eve nutzt dafür in erster Linie die langfristigen empirischen Daten der Tüpfelhyänen des Ngorongoro-Kraters, wendet für ihre Forschung aber auch vergleichende Ansätze an. Aktuell beschäftigt sie sich mit zwei Hauptthemen: (i) die Auswirkungen der demografischen und verwandtschaftlichen Dynamik auf soziale Konventionen und (ii) die öko-evolutionären Ursachen von Machtungleichheiten und Dominanzstilen bei sozialen Säugetieren. Gefördert von der DFG. Französin, US-Amerikanerin, Armenierin, Libanesin, mit mexikanischer Note. Philemon Naman. Unterstützt das Projekt seit 2015 als Assistent. Sammelt demographische Daten und Verhaltensdaten und sammelt genetische Proben für das Langzeit-Monitoring der Tüpfelhyänen-Populations des Ngorongoro-Kraters. Philemon führt monatliche Zählungen von Herbivoren durch, um die saisonalen Veränderungen der Beutetierdichte in den Hyänen-Territorien zu schätzen. Er spielt eine Schlüsselrolle bei der Aufrechterhaltung der Beziehungen zu den Parkbehörden, Interessengruppen und indigenen Völkern des Ngorongoro-Schutzgebiets. Er unterstützt uns bei der Wartung von Forschungsausrüstung und Fahrzeugen sowie bei der Beantragung von Genehmigungen. Er machte 2014 seinen Abschluss am College of African Wildlife Management in Mweka. Tansanier vom Stamm der Iraqw.
Philemon Naman. Unterstützt das Projekt seit 2015 als Assistent. Sammelt demographische Daten und Verhaltensdaten und sammelt genetische Proben für das Langzeit-Monitoring der Tüpfelhyänen-Populations des Ngorongoro-Kraters. Philemon führt monatliche Zählungen von Herbivoren durch, um die saisonalen Veränderungen der Beutetierdichte in den Hyänen-Territorien zu schätzen. Er spielt eine Schlüsselrolle bei der Aufrechterhaltung der Beziehungen zu den Parkbehörden, Interessengruppen und indigenen Völkern des Ngorongoro-Schutzgebiets. Er unterstützt uns bei der Wartung von Forschungsausrüstung und Fahrzeugen sowie bei der Beantragung von Genehmigungen. Er machte 2014 seinen Abschluss am College of African Wildlife Management in Mweka. Tansanier vom Stamm der Iraqw. Alexandre Courtiol. Leitender Wissenschaftler. Chef-Datenanalytiker und statistischer Berater seit 2013. Er beaufsichtigt die Entwicklung eines praktischen R-Pakets {hyenaR}, das viele von uns nutzen, um demografische und ökologische Daten aus der Ngorongoro-Hyänen-Datenbank zu extrahieren. Alex mischt mit, wenn es um Partnerwahl, sexuelle Selektion und Demografie geht. Er ist der Leiter der Data Zoo Gang, einer Forschungsgruppe des Leibniz-IZW, die sich auf die quantitative Biologie von Wildtieren und auf die Entwicklung von R-Paketen für Ökologie und Naturschutz spezialisiert hat. Franzose.
Alexandre Courtiol. Leitender Wissenschaftler. Chef-Datenanalytiker und statistischer Berater seit 2013. Er beaufsichtigt die Entwicklung eines praktischen R-Pakets {hyenaR}, das viele von uns nutzen, um demografische und ökologische Daten aus der Ngorongoro-Hyänen-Datenbank zu extrahieren. Alex mischt mit, wenn es um Partnerwahl, sexuelle Selektion und Demografie geht. Er ist der Leiter der Data Zoo Gang, einer Forschungsgruppe des Leibniz-IZW, die sich auf die quantitative Biologie von Wildtieren und auf die Entwicklung von R-Paketen für Ökologie und Naturschutz spezialisiert hat. Franzose. Liam Bailey. Postdoktorand seit 2018. Er ist Klimawandel-Ökologe mit großem Interesse an der Nutzung datenwissenschaftlicher Techniken für den Naturschutz. Sein wissenschaftliches Interesse gilt dem Verständnis der Auswirkungen von Veränderungen in der biotischen und abiotischen Umwelt auf natürliche Systeme, insbesondere auf wildlebende Populationen von Vögeln und Säugetieren. Seine aktuelle Arbeit zielt darauf ab, die demografischen Reaktionen von Hyänen-Krater-Clans auf den Klimawandel zu quantifizieren. Er ist für das Wetterdatenmanagement und den Wissenstransfer (durch praktische Workshops vor Ort) verantwortlich. Liam ist ein Mitglied der Data Zoo Gang. Er hat mehrere R-Pakete entwickelt, darunter {hyenaR} und {climwin}. DAAD & DFG-Stipendium. Australier.
Liam Bailey. Postdoktorand seit 2018. Er ist Klimawandel-Ökologe mit großem Interesse an der Nutzung datenwissenschaftlicher Techniken für den Naturschutz. Sein wissenschaftliches Interesse gilt dem Verständnis der Auswirkungen von Veränderungen in der biotischen und abiotischen Umwelt auf natürliche Systeme, insbesondere auf wildlebende Populationen von Vögeln und Säugetieren. Seine aktuelle Arbeit zielt darauf ab, die demografischen Reaktionen von Hyänen-Krater-Clans auf den Klimawandel zu quantifizieren. Er ist für das Wetterdatenmanagement und den Wissenstransfer (durch praktische Workshops vor Ort) verantwortlich. Liam ist ein Mitglied der Data Zoo Gang. Er hat mehrere R-Pakete entwickelt, darunter {hyenaR} und {climwin}. DAAD & DFG-Stipendium. Australier. Larissa Arantes. Postdoktorandin seit 2022. Larissa ist spezialisiert auf die Anwendung genomischer Methoden zur Erhaltung der biologischen Vielfalt. Sie erstellt genomische Markerdaten für Tausende von Tüpfelhyänen über acht Generationen, um die genetische Vielfalt sowie die evolutionären und ökologischen Auswirkungen der aktuellen Umweltveränderungen auf die Hyänenpopulation im Ngorongoro-Krater zu quantifizieren. Ihre Arbeit wird in enger Zusammenarbeit mit Dr. Camila Mazzoni von BeGenDiv und Prof. Loeske Kruuk von der Universität Edinburgh durchgeführt. ERC-Stipendium. Brasilianerin.
Larissa Arantes. Postdoktorandin seit 2022. Larissa ist spezialisiert auf die Anwendung genomischer Methoden zur Erhaltung der biologischen Vielfalt. Sie erstellt genomische Markerdaten für Tausende von Tüpfelhyänen über acht Generationen, um die genetische Vielfalt sowie die evolutionären und ökologischen Auswirkungen der aktuellen Umweltveränderungen auf die Hyänenpopulation im Ngorongoro-Krater zu quantifizieren. Ihre Arbeit wird in enger Zusammenarbeit mit Dr. Camila Mazzoni von BeGenDiv und Prof. Loeske Kruuk von der Universität Edinburgh durchgeführt. ERC-Stipendium. Brasilianerin. Marta Mosna. Doktorandin seit Juni 2023. Marta widmet sich der Entschlüsselung der Komplexität von Dominanzstilen und Hierarchieeigenschaften bei Tüpfelhyänen. Ihre Forschung ist Teil des Gemeinschaftsprojekts „DESPOT“, das sich mit der Evolution despotischer Gesellschaften bei Säugetieren befasst und darauf abzielt, die evolutionären Ursprünge von Variationen in sozialen Beziehungen und hierarchischen Strukturen bei gruppenlebenden Säugetieren aufzudecken. Dabei wird Marta eng mit Tal Kleinhause-Goldman Gedalyahou und Dr. Elise Huchard (ISEM-Frankreich) und Dr. Dieter Lukas (Max-Planck EVA, Leipzig) zusammenarbeiten. Betreut von Oliver, Eve, und den Professoren Jens Rolff (FU) und Jens Krause (FU, Leibniz-IGB). Gefördert durch die DFG. Italiernerin.
Marta Mosna. Doktorandin seit Juni 2023. Marta widmet sich der Entschlüsselung der Komplexität von Dominanzstilen und Hierarchieeigenschaften bei Tüpfelhyänen. Ihre Forschung ist Teil des Gemeinschaftsprojekts „DESPOT“, das sich mit der Evolution despotischer Gesellschaften bei Säugetieren befasst und darauf abzielt, die evolutionären Ursprünge von Variationen in sozialen Beziehungen und hierarchischen Strukturen bei gruppenlebenden Säugetieren aufzudecken. Dabei wird Marta eng mit Tal Kleinhause-Goldman Gedalyahou und Dr. Elise Huchard (ISEM-Frankreich) und Dr. Dieter Lukas (Max-Planck EVA, Leipzig) zusammenarbeiten. Betreut von Oliver, Eve, und den Professoren Jens Rolff (FU) und Jens Krause (FU, Leibniz-IGB). Gefördert durch die DFG. Italiernerin. Ella White. Doktorandin seit November 2022. Ella ist spezialisiert auf die Modellierung von ökologischen Prozessen und demographischen Reaktionen wildlebender Populationen auf Störungen. Sie untersucht die Widerstandsfähigkeit der Tüpfelhyänen des Ngorongoro-Kraters und des Serengeti-Nationalparks auf sozio-ökologische Störungen. Ellas übergeordnetes Ziel ist die Entwicklung eines neuen analytischen Ansatzes zur Quantifizierung solcher demografischen Reaktionen und die Bereitstellung von Instrumenten für den angewandten Naturschutz. Sie wird von Oliver, Dr. Viktoriia Radchuk, Dr. Sarah Benhaiem (beide von der Abteilung Ecological Dynamics des Leibniz-IZW’s sowie den Professoren Jens Rolff (FU) und Adam Clark (Universiät Graz) betreut. Sie arbeitet eng mit Dr. Julie Louvrier vom Leibniz-IZW zusammen. Finanziert durch das Bundesministerium für Bildung unf Forschung (BMBF). Kiwi (aka Neuseeländerin).
Ella White. Doktorandin seit November 2022. Ella ist spezialisiert auf die Modellierung von ökologischen Prozessen und demographischen Reaktionen wildlebender Populationen auf Störungen. Sie untersucht die Widerstandsfähigkeit der Tüpfelhyänen des Ngorongoro-Kraters und des Serengeti-Nationalparks auf sozio-ökologische Störungen. Ellas übergeordnetes Ziel ist die Entwicklung eines neuen analytischen Ansatzes zur Quantifizierung solcher demografischen Reaktionen und die Bereitstellung von Instrumenten für den angewandten Naturschutz. Sie wird von Oliver, Dr. Viktoriia Radchuk, Dr. Sarah Benhaiem (beide von der Abteilung Ecological Dynamics des Leibniz-IZW’s sowie den Professoren Jens Rolff (FU) und Adam Clark (Universiät Graz) betreut. Sie arbeitet eng mit Dr. Julie Louvrier vom Leibniz-IZW zusammen. Finanziert durch das Bundesministerium für Bildung unf Forschung (BMBF). Kiwi (aka Neuseeländerin). Arjun Dheer. Doktorand seit 2017. Er untersucht die Koexistenz von Mensch und Raubtier und die Reaktionen von Tüpfelhyänen auf anthropogene Aktivitäten im Ngorongoro-Schutzgebiet. Seine Arbeit zielt darauf ab, die lokale Wahrnehmung von Großraubtieren und Managementstrategien der Maasai anhand von Fragebögen zu bewerten und die Auswirkungen von menschlichen Aktivitäten und der Beutedichte auf die Demographie von Tüpfelhyänen innerhalb und außerhalb des Kraters zu ermessen. Arjun arbeitet auch an Projekten mit, die sich mit der angewandten Ökologie und der Erhaltung von Raubtieren in Afrika und Asien befassen. Leibniz-IZW-Stipendium. Ist Verantwortlicher für die Rote Liste der IUCN Hyena Specialist Group und ein National Geographic Explorer. US-Amerikaner und Inder.
Arjun Dheer. Doktorand seit 2017. Er untersucht die Koexistenz von Mensch und Raubtier und die Reaktionen von Tüpfelhyänen auf anthropogene Aktivitäten im Ngorongoro-Schutzgebiet. Seine Arbeit zielt darauf ab, die lokale Wahrnehmung von Großraubtieren und Managementstrategien der Maasai anhand von Fragebögen zu bewerten und die Auswirkungen von menschlichen Aktivitäten und der Beutedichte auf die Demographie von Tüpfelhyänen innerhalb und außerhalb des Kraters zu ermessen. Arjun arbeitet auch an Projekten mit, die sich mit der angewandten Ökologie und der Erhaltung von Raubtieren in Afrika und Asien befassen. Leibniz-IZW-Stipendium. Ist Verantwortlicher für die Rote Liste der IUCN Hyena Specialist Group und ein National Geographic Explorer. US-Amerikaner und Inder. Dora Berger. Masterstudentin (Universität Zagreb, Kroatien) seit Februar 2023. Sie untersucht die Wurzeln der sozio-sexuellen Beziehungen zwischen Männchen und Weibchen bei Tüpfelhyänen. Konkret untersucht Dora, ob Männchen unterschiedliche Strategien anwenden, um Beziehungen zu den Weibchen aufzubauen, und wie die Lebensgeschichte von Männchen und Weibchen damit zusammenhängen. Zu diesem Zweck wird sie über 2000(!) Videoaufnahmen des Verhaltens unserer geliebten Krater-Tüpfelhyänen analysieren. Betreut von Eve, Oliver und Prof. Zoran Tadić (Universität Zagreb, Kroatien). Kroatin.
Dora Berger. Masterstudentin (Universität Zagreb, Kroatien) seit Februar 2023. Sie untersucht die Wurzeln der sozio-sexuellen Beziehungen zwischen Männchen und Weibchen bei Tüpfelhyänen. Konkret untersucht Dora, ob Männchen unterschiedliche Strategien anwenden, um Beziehungen zu den Weibchen aufzubauen, und wie die Lebensgeschichte von Männchen und Weibchen damit zusammenhängen. Zu diesem Zweck wird sie über 2000(!) Videoaufnahmen des Verhaltens unserer geliebten Krater-Tüpfelhyänen analysieren. Betreut von Eve, Oliver und Prof. Zoran Tadić (Universität Zagreb, Kroatien). Kroatin. Leonie Walter. Masterstudentin (Freie Universität Berlin) seit Oktober 2022. Sie untersucht die Auswirkungen der Partnerwahl von Weibchen auf die Verwandtschaft zwischen den Individuen eines Clans. Für ihre Arbeit nutzt Leonie unseren genetischen Stammbaum, der die Familienbande von über 3000 Hyänen und 9 Generationen der Kraterhyänen-Population detailliert beschreibt. Betreut von Alex. Deutsche.
Leonie Walter. Masterstudentin (Freie Universität Berlin) seit Oktober 2022. Sie untersucht die Auswirkungen der Partnerwahl von Weibchen auf die Verwandtschaft zwischen den Individuen eines Clans. Für ihre Arbeit nutzt Leonie unseren genetischen Stammbaum, der die Familienbande von über 3000 Hyänen und 9 Generationen der Kraterhyänen-Population detailliert beschreibt. Betreut von Alex. Deutsche. Loltogom Oltumo, Tegela Karya and Jose Karya. Stießen 2007 zum Projekt. Bewachen das Forscherhaus und helfen bei der Wartung der Ausrüstung und dem Austausch wichtiger Informationen mit den Wildhütern und den Massai der nahegelegenen Dörfer. Tansanier vom Stamm der Massai.
Loltogom Oltumo, Tegela Karya and Jose Karya. Stießen 2007 zum Projekt. Bewachen das Forscherhaus und helfen bei der Wartung der Ausrüstung und dem Austausch wichtiger Informationen mit den Wildhütern und den Massai der nahegelegenen Dörfer. Tansanier vom Stamm der Massai.Ehemalige Mitglieder und -wirkende:
Malvina Andris (technische Assistentin), Nelly Boyer (technische Assistentin), Nicole Burgener (technische Assistentin), Renita Danabalan (Postdoc), Elisa Donati (Praktikantin), Noon Bushra Eltahir (studentische Hilfskraft), Anne Hertel (wissenschaftliche Hilfskraft), Lekoko Kimaay (freier Assistent), Berit Kostka (technische Assistentin), Zimai Li ( Masterstudent), Michelle Lindson (technische Assistentin), Angelika Mai (technische Assistentin), Tapwaa Ndooto (freier Assistent), Sylvia Schulz van Endert (wissenschaftliche Hilfskraft), Melanie Szameitat (freiwillige ÖBFD), Alexis Verfaillie (Masterstudent), Colin Vullioud (freiwilliger ÖBFD und wissenschaftliche Hilfskraft), Bettina Wachter (Wissenschaftlerin und Projekt-Mitgründerin), Kerstin Wilhelm (technische Assistentin).
Our Collaborators
- Dr. Camila Mazzoni (BeGenDiv).
- Prof. Loeske Kruuk (University Edinburgh).
- Dr. Laly Lichtenfeld (Tanzania People & Wildlife). Human-carnivore coexistence in the NCA.
- Dr. Elise Huchard (ISEM-France). Intersexual power relationships and dominance.
- Prof. Peter Kappeler (Leibniz-DPZ). Sex ratio & Intersexual power relationships.
- Dr. Timothée Bonnet (ANU). Quantitative genetics & Evolution of fitness.
- Dr. Sam Ellis and Prof. Darren Croft (University of Exeter). Causes and consequences of kinship dynamics.
- Dr. Viktoriia Radchuk (Leibniz-IZW). Quantitative ecology. Modelling demographic resilience.
- Dr. Sarah Benhaiem (Leibniz-IZW). Co-director of Serengeti Hyena Project.
- Dagmar Thierer and Stephan Karl (Leibniz-IZW). Technical assistants. Perform parentage analyses of the Crater hyenas based on microsatellite fingerprinting.
- Dr. Jella Wauters (Leibniz-IZW). Wildlife endocrinology. Performs ELISA for quantification of cortisol metabolities in hyenas feces.
Die Basis
Das Forscherhaus befindet sich am Rand des Kraters und wird von der Ngorongoro Conservation Area Authority zur Verfügung gestellt. In der Nähe befinden sich ein Stationshaus für Wildhüter, die Ost-Einfahrt in den Krater und die Ngorongoro Sopa Lodge. Das nächstgelegene Massaidorf liegt 5 km weit entfernt. Die nächste Einkaufsmöglichkeit gibt es ca. eine Fahrstunde entfernt in Karatu.
Die Station wird mit Solarenergie betrieben und ist wie ein funktionierendes Büro ausgestattet mit Computer, Drucker, Scanner etc. Den Zugang zum Internet liefert eine Satellitenschüssel. Ein Raum wurde zu einem Mini-Labor mit Zentrifuge, Behälter mit flüssigem Stickstoff und anderem umfunktioniert. Darin können Sektionen durchgeführt und Proben aufbewahrt und bearbeitet werden.